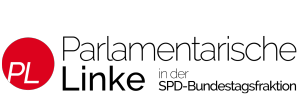Anlässlich der heutigen Amtseinführung Joe Bidens als neuer US-Präsident
Der 20. Januar ist traditionell ein Festtag der US-amerikanischen Demokratie. Alle vier Jahre wird an diesem Datum die Amtseinführung des Gewinners bzw. der Gewinnerin der im November zuvor durchgeführten Präsidentschaftswahlen zelebriert. Durch die Amtseinführung wird Akzeptanz des Ausgangs freier und fairer Wahlen zum Ausdruck gebracht und die friedliche Machtübergabe vollzogen. Dies sind Kernelemente der US-amerikanischen Demokratie und normalerweise eine Selbstverständlichkeit. Die Falschbehauptungen Donald Trumps hinsichtlich des klaren Wahlergebnisses und die gezielt gesäte antidemokratische Stimmung haben in den vergangenen Wochen und Monaten jedoch ein Klima bereitet, das den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar nicht nur möglich gemacht, sondern aktiv gefördert hat. Die Bilder dieses Aktes der Verachtung demokratischer Grundregeln lassen uns an diesem feierlichen Tag daher nicht nur mit Freude, sondern auch mit Sorge über den Atlantik blicken. Dennoch wissen wir natürlich um die Stärke der durch ihre lange Tradition gefestigte US-amerikanischen Demokratie.
Die Herausforderungen sind gigantisch
Trotz der durch das destruktive Verhalten Donald Trumps geprägten und entsprechend komplizierten Übergangsphase werden sich der neue Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris nach dem Motto „hit the ground running“ unmittelbar an die Arbeit machen müssen. Die Herausforderungen, vor denen das neue Team steht, sind gigantisch. Das akuteste Thema ist sicherlich die Bewältigung der Corona-Pandemie, die in den USA besonders dramatisch wütet. Jenseits der bedrückenden Zahl an Infizierten und Verstorbenen haben viele US-Bürgerinnen und US-Bürger aufgrund der Wirtschaftskrise ihre Arbeit verloren. Die nur in geringem Maße ausgeprägten sozialen Sicherheitsnetze können die dadurch entstandenen finanziellen Schäden privater Haushalte nicht wirkmächtig abfedern. Auf diese Weise droht die Corona-Pandemie die bereits jetzt beachtliche sozio-ökonomische Ungleichheit innerhalb der USA noch weiter zu verschärfen.
Gleichzeitig sehen sich Joe Biden und Kamala Harris auch anderen Spaltungstendenzen der US-amerikanischen Gesellschaft gegenüber – wie bspw. hinsichtlich der Themen Rechtspopulismus und Rassismus. Nach vier Jahren der Trump-Präsidentschaft sind die USA enorm polarisiert und die Aufgabe, das Land wieder zu einen, scheint eine Mammutarbeit. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass die Existenz des Trumpismus mit der Amtszeit Donald Trumps am heutigen Tage endet. Ob diese Aufgabe gelingen kann, wird sich aber auch maßgeblich dadurch entscheiden, welchen Weg die Republikaner einschlagen. Eine Demokratie braucht loyale Demokratinnen und Demokraten, die sich aktiv für sie einsetzen. Aus diesem Grund ist eine entschlossene Wiederkehr der GOP zu den demokratischen Gepflogenheiten essenziell für die Stabilität der US-Demokratie insgesamt.
Neben diesen innenpolitischen Themen sind auch die internationalen Herausforderungen für die neue US-Administration beachtlich. Nach vier Jahren des nationalistischen und protektionistischen America-First-Kurses sind die internationalen Erwartungen an eine aktivere und multilateral ausgerichtete US-Außenpolitik groß. Eine erneute Stärkung des in den vergangenen Jahren dramatisch geschwächten Rüstungskontrollregimes bspw. wird nur mit den USA effektiv gelingen. Das gilt ebenso mit Blick auf die multilaterale Zusammenarbeit als zentralem Ansatz zur Lösung internationaler Aufgaben und Probleme, wie u.a. zur gemeinsamen Bekämpfung des Klimawandels. Die Ankündigung Bidens, dem Pariser Klimaabkommen bereits am ersten Tag seiner Amtszeit wieder beizutreten, ist in diesem Kontext ein wertvoller erster Schritt. Aber auch darüber hinaus eröffnen die Werte und Positionen des 46. US-Präsidenten zumindest die Chance auf eine künftig wieder konstruktivere und engere transatlantische Zusammenarbeit.
Die Erneuerung einer starken Partnerschaft
Die transatlantischen Beziehungen sind für Deutschland wie für Europa insgesamt von hoher Bedeutung – sowohl historisch als auch politisch und gesellschaftlich. Donald Trump hat die transatlantischen Beziehungen in den letzten Jahren ohne Frage auf eine beispiellose Probe gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten ist aber weiterhin unser ureigenes Interesse. Die neue US-Administration verkörpert – insbesondere mit Blick auf die von Biden für zentrale Kabinettsposten nominierten Personen – Erfahrung und betont den Wert einer konstruktiven und multilateralen internationalen Zusammenarbeit.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die transatlantische Partnerschaft gemeinsam wieder stärken und unsere Zusammenarbeit intensivieren können. Wir können gemeinsame Positionen auf der internationalen Bühne überzeugender und wirkungsmächtiger vertreten. Das gilt zum einen für Themen wie den Klimawandel, zum anderen aber auch mit Blick auf das Erstarken von Rechtspopulismus und Autoritarismus. Insbesondere der Schutz und die Stärkung unserer Demokratien ist ein zentrales gemeinsames Anliegen. Schließlich handelt es sich bei den oben genannten innenpolitischen Herausforderungen der USA hinsichtlich der zunehmenden Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft um Herausforderungen, vor denen auch wir in Europa stehen – wenn auch teilweise in einem anderen Ausmaß.
Wir wollen und müssen diese Chance daher entschieden nutzen und die transatlantische Partnerschaft gemeinsam wieder lebendiger gestalten. Gleichzeitig bleibt es richtig, den europäischen Pfeiler innerhalb der transatlantischen Beziehungen zu stärken und in diesem Zuge der europäischen Souveränität Vortrieb zu leisten.