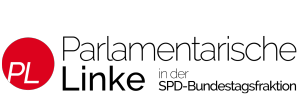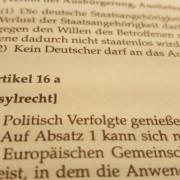Wenn die verfassungsrechtlich garantierte kommunale Selbstverwaltung ernst genommen wird, müssen die Kommunen die Freiheit haben, die Lebensbedingungen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu gestalten. Gerechtigkeit beginnt häufig in den Bildungseinrichtungen der eigenen Kommune und setzt sich über die Arbeits- und Lebensbedingungen fort. Sozialdemokratische Politik in und für Kommunen muss deshalb drauf ausgerichtet sein, die lokale Ebene so zu stärken, dass sie strukturell in der Lage ist, kommunale Selbstverwaltung mit Leben zu füllen. An diesem Grundverständnis wird sich die Programmatik der SPD auch in der Zukunft orientieren. Bevor wir die zukünftigen Fragen diskutieren, lohnt der Blick auf die Ergebnisse der SPD in der Bundesregierung.
Ausgangslage: Viel vorgenommen
Selten zuvor hat die Lage der Kommunen in einem Wahlprogramm der SPD eine so herausgehobene Position gehabt. Gleiches gilt auch für den Koalitionsvertrag. Ohne es im Einzelnen hier zu rekapitulieren, darf begründet gesagt werden, dass die Positionen zur Stärkung der Kommunen für viele Mitglieder ein ausschlaggebender Grund gewesen sind, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen.
Wer die Kommunen in Deutschland in den Blick nimmt, kommt um Differenzierung nicht herum. Vielen Kommunen geht es – gemessen an der finanziellen Lage von Bund und Ländern – vergleichsweise gut. Wer nur auf den finanziellen Gesamtabschluss blickt, wird sogar feststellen, dass die Kommunen über alles gesehen in mehreren Jahren Überschüsse erzielten. Unter der statistischen Durchschnittsbetrachtung wird gleichsam spiegelbildlich zur Drift zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft erkennbar, wie stark die Lebensverhältnisse in Deutschland zwischen einzelnen Kommunen auseisandergehen.
Im Kern sind es drei Hauptprobleme, die die Kommunen belasten:
- die Höhe und Entwicklungsdynamik (nicht deren Berechtigung) sozialer Leistungen in Deutschland, von denen die Kommunen erhebliche Anteile tragen müssen; derzeit sind es fast 60 Mrd. Euro. jährlich.
- die sowohl finanzpolitisch als auch im Verhältnis zum notwendigen Infrastukturerhalt nachweisbare Investitionsschwäche, die einer nachhaltigen und demografiefesten Politik entgegensteht. Allein unter Status-quo-Bedingungen stehen einem Investitionsbedarf von rund 140 Mrd. Euro jahresdurchschnittlich Investitionen in einer Größenordnung von rund 23 Mrd. Euro gegenüber.
- die aus gesamtstaatlicher Perspektive zu hohe Verschuldung einzelner Kommunen (wie auch ihrer Gesamtheit) in einer Größenordnung von rund 140 Mrd. bei einem Bestand an Kassenkrediten von rund 54 Mrd. Euro.
Ungeachtet dieser seit langem wirksamen Entwicklung, ist die Lage durch die große Zahl und die Geschwindigkeit der Aufnahme von Flüchtlingen weiter erschwert worden. Konsolidierungspfade mussten nochmals verlängert, Infrastrukturkonzepte revidiert und schmerzhafte Einschnitte wiederholt werden, von Leistungsverbesserungen nicht zu reden.
Weil sich diese Elemente aber nicht überall und schon gar nicht in gleicher Tiefe zeigen, sondern zu einem Teil konzentriert in Städten und Stadtregionen auftreten, die ohnehin gebeutelt sind, entwickelt sich die Lebensqualität in Deutschland nachweisbar auseinander. Die Steuerkraft der ostdeutschen Gemeinden stagniert weiterhin bei nur rund 60 Prozent des Niveaus der alten Bundesländer. Die Sozialausgaben je Einwohner sind demgegenüber mit 853 Euro in Nordrhein-Westfalen am höchsten, Sachsen-Anhalt liegt dagegen bei 405 Euro je Einwohner. Und auch innerhalb der einzelnen Länder ist das Gefälle bei der kommunalen Steuerkraft enorm, etwa im „reichen“ Bayern: 2015 lagen die Steuereinnahmen je Einwohner im Kreis München bei 3.440 Euro, in Bayreuth bei lediglich 740 Euro.
Disparitäre Lebensbedingungen wiederum müssen auch den Bund auf den Plan rufen, trägt er doch für die Sicherung gleichwertiger Lebensbedingen eine maßgebliche (aber nicht die einzige) Verantwortung.
Ergebnisse: Viel erreicht
Durchaus vergleichbar wie nach dem Regierungswechsel von Jürgen Rüttgers (CDU) zu Hannelore Kraft (SPD) in NRW 2010 vollzog sich auch im Bund ein deutlicher Perspektivenwechsel zugunsten der Kommunen. Nach gut drei von vier Jahren der GroKo kann die SPD für sich begründet in Anspruch nehmen, der Anwalt der Kommunen im Bund zu sein.
Welche Maßnahmen zur Entlastung von Sozialkosten, Stärkung der Investitionskraft und Schuldenproblematik wurden ergriffen?
Experten wie auch kommunale Spitzenverbände bestätigen der Großen Koalition, soviel für die Kommunen auf den Weg gebracht zu haben, wie vermutlich keine Regierung zuvor: Das Bundesfinanzministerium listet für den Zeitraum 2014 – 2017 (18. WP) mehr als 65 Milliarden Euro auf, mit denen Länder und Kommunen in dieser Legislaturperiode unterstützt worden sind (auch wenn nicht in allen Fällen die kommunalen Mittel beim Umweg über die Länderhaushalte ihr Ziel erreichen).
Die Liste der Maßnahmen umfasst:
Quelle: Finanzbericht 2017| Betrag / Euro | Maßnahme |
|---|
| 25 Mrd. | vollständige Erstattung Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| 11,3 Mrd. | Entflechtungsmittel |
| 5 Mrd. | Erstattung der Ausgaben bei Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (mit Abschlag im Jahr 2016) |
| 5 Mrd. | Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (BBKdU) und der Sonderquote für Bildungs- und Teilhabeaufwendungen |
| 4,2 Mrd. | vollständigen Übernahme des BAföG durch den Bund |
| 4,1 Mrd. | Beitrag des Bundes zum Ausbau der Kinderbetreuung |
| 3,5 Mrd. | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (finanzschwacher Kommunen) |
| 3 Mrd. | Höherer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und höherer BBKdU |
| 1,5 Mrd. | 2017 zur Stärkung kommunaler Investitionskraft (höherer Ge¬meindeanteil an der Umsatzsteuer und höhere BBKdU) |
| 1,1 Mrd. | höherer Länderanteil Umsatzsteuer wg. Wegfall des Betreuungsgeldes |
| 0,8 Mrd. | Unterstützungsleistungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen durch die BIMA |
| 0,7 Mrd. | Kostenerstattung von Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
| 0,6 Mrd. | Breitbandausbau in Kommunen in unterversorgten Gebieten |
Die damit erbrachten Unterstützungen entlasten die Kommunen von Ausgaben, deren Verursachung sie kaum steuern können und für die die Verantwortung überwiegend beim Bundesgesetzgeber liegt. Insbesondere diese Förderung wird durch die ab 2018 dauerhaft laufende Kommunalentlastung in Höhe von 5 Mrd. jährlich fortgeschrieben. Wir wollten andere Verteilungskriterien. Beschlossen wurde allerdings eine erhöhte kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung und eine nachgeordnete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft. Damit haben die Entlastungen zwar nicht so sehr vorrangig den finanzschwachen Kommunen geholfen, die Entlastungswirkung ist dennoch ein großer politischer Erfolg.
Gleiches gilt auch für die Vereinbarungen im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Die Aufstockung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes um weitere 3,5 Mrd. Euro auf dann 7 Mrd. Euro stärkt die kommunale Investitionskraft erheblich.
Gerade diese Aufgabe wird auch über die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für den Wohnungsbau flankiert: Im Kontext des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes hat der Bund 2016 bis 2019 die Mittel für den sozialen Wohnungsbau um jährlich 500 Mio. Euro erhöht. Nochmals werden diese Mittel in 2017 und 2018 um 500 Mio. Euro im Rahmen der Kompensationsmittel den Ländern zur Verfügung gestellt. Die Gesamtausgaben des Bundes für den sozialen Wohnungsbau im Zeitraum von 2015 bis 2019 betragen damit 5,5 Mrd. Euro.
Mindestens weiterer Erwähnung bedarf die erhebliche Steigerung der Mittel für das Programm „Soziale Stadt“ im Rahmen der Städtebauförderung, die seit 2014 von 455 auf 700 Mio. jährlich erhöht und nochmals um jährlich 300 Mio. Euro für die Jahre 2017 bis 2020 aufgestockt wurden.
Ungeachtet der fehlenden kleineren Maßnahmen darf resümiert werden, dass sowohl zur Entlastung der Sozialausgaben als auch zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, um der kommunalen Selbstverwaltung wieder größeren Handlungsspielraum zu verschaffen.
Finanzierung der Flüchtlingsbewegung
Seit im Laufe des Jahres 2015 die Flüchtlingszahlen stark anstiegen sind, hat der Bund erhebliche Aufwendungen getätigt, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Jenseits der zunächst vorrangigen Aufnahme und Unterbringung war es uns wichtig, finanzielle Bedingungen zu schaffen, unter denen Integration erfolgreich sein kann und die Kommunen nicht auf den Kosten sitzen zu lassen. Im Streit zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist es allerdings nicht nur der Bund, der sich die Frage stellen muss, ob die Kommunen bei der erforderlichen Integration hinreichend unterstützt werden. Die vom Bund bereitgestellten dreimal 2 Mrd. Euro Integrationspauschale für die Jahre 2016 bis 2018 werden gar nicht oder nur in homöopathischen Dosen von den Ländern an die Kommunen weitergegeben.
Die Finanzierung des Flüchtlingszuzugs wird so oder so eine der wichtigen Aufgaben der kommenden Jahre bleiben und damit auch in Zukunft die Diskussion mitbestimmen. Oft genug mussten wir für diese Politik den Widerstand unseres Koalitionspartners überwinden, dem es im Zweifel wichtiger ist, eine schwarze Null zu präsentieren. Um des kleinkarierten Vorteils willen, werden die Länder von den Konservativen als „Geier“ diffamiert oder deren Finanzprobleme unter Hinweis auf klebrige Finger miniaturisiert. Dessen ungeachtet haben wir uns aber durchsetzen können. Eine wirklich gute Bilanz.
Perspektiven: Aufgabe erledigt?
Ist nach den Milliardenentlastungen in dieser Legislaturperiode die Wende geschafft? Leider nein, lautet die kurze Antwort. Den Entlastungen auf der einen Seite stehen Belastungen auf der anderen Seite gegenüber: Angefangen von der Pflegeversicherung über steuerrechtliche Änderungen bis zum Bundesteilhabegesetz stehen immer wieder neue Herausforderungen auf der Tagesordnung. Zusätzliche staatliche Leistungen – die der Bund beschließt, die aber häufig von den Kommunen erbracht werden – müssen vollumfänglich vom Bund finanziert werden.
Gerade die politische Linke muss dabei darauf achten, dass die Finanzierung der Sozialkosten nicht einfach in eine Debatte über deren Berechtigung umgemünzt wird. Es geht nicht um den Sozialstaat, sondern um die Finanzierungsverantwortung. Mit dem Hinweis auf die Konnexität – wie in den Landesgesetzen und –verfassungen geregelt, kommt man auf der Bundesebene wegen der föderalen Verantwortungszuordnung nicht weit. Das strukturelle Problem der Kommunalfinanzierung besteht darin, dass die Einnahmeseite eher wirtschafts- und steuerkraftbezogen, die Ausgabeseite hingegen sozialinduziert ist: Kommunalhaushalte sind weit mehr Sozial- statt Investitionshaushalte. Auf die Sozialausgaben haben die Kommunen aber nur sehr begrenzt Einfluss. Deshalb ist der Hinweis, bei sparsamer Haushaltsführung könne auch der Haushaltsausgleich erreicht werden, nur dort angebracht, wo die sozialen Problemlagen klein sind. Das ist zumeist in Ballungsgebieten, in denen der Strukturwandel durch Rückgang der Grundstoffindustrien massiv ist, nicht der Fall.
Zwei Hauptstränge sind auch in der Zukunft zuvörderst zu bearbeiten:
- Gerecht: Die Kommunalfinanzierung muss auskömmlich sein. Eine dem Kommunalisierungsgrad angemessene Finanzausstattung ist nicht mehr gegeben. Dieses Thema knüpft an die grundsätzliche Steuerverteilung zwischen Bund (42,5%), Ländern (42,5%) und Kommunen (15%) an und schließt die kommunale Beteiligung am Landesanteil der Steuern (Verbundsatz) ein.
- Gleich: Regionale Ungleichheit der kommunalen Finanzkraft darf nicht zu Ungleichheit der Lebensbedingungen werden. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland zwischen und innerhalb von Regionen muss ein Maßstab bleiben. Diesem Ziel könnte zum Beispiel besser gefolgt werden, wenn die Steuerbeteiligung der Kommunen die Soziallasten besser berücksichtigen würde. Die kommunale Umsatzsteuerbeteiligung setzt sich beispielsweise durch einen Indikator aus Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50%), Lohnsumme sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (25%) und Gewerbesteueraufkommen (25%) zusammen. Arbeitslosigkeit oder andere Sozialindikatoren spielen keine Rolle. Würden diese Kriterien stärker berücksichtigt, wäre mehr Gleichheit in der Steuerverteilung erreichbar.
Ein solches Fundament wäre zweifellos eine zukunftsfähigere Perspektive als im regelmäßigen Rhythmus „Entlastungen“ zu verkünden, die doch zuvor als Belastungen beschlossen worden sind. Eigene Finanzierungsquellen wie die Gewerbesteuer oder auch die Grundsteuer müssen dazu stabilisiert, weiterentwickelt, aber nicht ausgehöhlt werden. Wenn Abschreibungen dauerhaft höher sind als die Investitionen ist Zukunftsfähigkeit gefährdet. Diesen Prinzipien zu folgen, bedeutet nicht, von zielgerichteter Politik in einzelnen Handlungsfeldern Abstand zu nehmen.
Die Themenfelder sind zahlreich, wie die Bilanz bereits gezeigt hat. Neue Aufgaben werden uns fordern: die Digitalisierung der Gesellschaft, der demografische Wandel, die weltweite Migration sind nur drei Bereiche, die ihren Niederschlag in den Kommunen finden.
Die SPD hat in der laufenden Wahlperiode gezeigt, dass sie im Bund der Anwalt der Kommunen ist. Soll es so bleiben, notabene: Wahlen haben Konsequenzen.