Die globale Corona-Pandemie ist die wohl größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bundesregierung hat daher ein beispielloses Maßnahmenpaket geschaffen, um die Ausbreitung von Corona einzudämmen und die wirtschaftlichen Folgen aufzufangen. Es wird dabei helfen, dass Deutschland diese Krise übersteht. Die letzten Wochen zeigen, dass diese Bundesregierung insgesamt gerade in schwierigen Zeiten gut arbeitet, nicht zuletzt auch wegen der geradlinigen und konzentrierten Arbeit von Vizekanzler Olaf Scholz und den sozialdemokratischen Ministerinnen und Ministern Franziska Giffey, Hubertus Heil, Christine Lambrecht, Heiko Maas und Svenja Schulze. Die vielen auf den Weg gebrachten Maßnahmen erreichen große Teile der Bevölkerung schnell und unbürokratisch. Als Sozialstaat fängt er in Not geratene Menschen in der Krise auf, seine Schutzschirme helfen den kleinen wie den großen Unternehmen. Weitere Maßnahmen insbesondere zum Schutz von Beschäftigten mit geringeren Einkommen und Erwerbslosen scheitern allerdings bislang an CDU und CSU.
Schon jetzt sehen wir aber auch, wie die Corona-Pandemie die bestehenden Ungleichheiten in Europa verschärft und zu einer existenziellen Herausforderung für die Europäische Union und den Euro-Raum wird. Eine Verschärfung der Krise, Massenarbeitslosigkeit und eine mögliche Renationalisierung gilt es zu verhindern. Wir wollen ein Europa, welches solidarisch zusammensteht. Dafür braucht es koordinierte nationale und europäische Hilfs- und Wachstumsprogramme. Die nun zu ergreifenden Maßnahmen werden die gesellschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre mitbestimmen. Wir alle stehen vor einer Richtungsentscheidung:
Entweder überlassen wir die Gesundheitsvorsorge weiterhin dem Markt, sparen Deutschlands und Europas Zukunft kaputt und wälzen die Kosten der Krise ab auf die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Dabei wird sich an den schlechten Arbeitsbedingungen von vielen, die gerade jetzt in der Krise den Laden am Laufen halten, von allein wenig ändern. Der Markt kümmert sich nicht um gute Löhne im Gesundheitsbereich oder im Einzelhandel. Und er sorgt auch nicht für Krisenzeiten vor.
Oder aber wir schlagen einen anderen Weg ein und setzen uns für einen starken und handlungsfähigen Staat als Motor gesellschaftlicher Entwicklung ein. Für eine Gesundheits- und Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand, die allen gleichermaßen zugänglich ist. Für eine koordinierte nationale und europäische Wirtschaftspolitik zur Überwindung der Krise und einen auf Nachhaltigkeit, Innovation und gute Beschäftigung ausgerichteten sozial-ökologischen Deal für Europa.
Wir als sozialdemokratische Abgeordnete sind der festen Überzeugung, dass es uns nur gelingt die Spaltung in Arm und Reich einzudämmen und Europa zusammenzuhalten, wenn wir dem Markt und der reinen Gewinnlogik klare Regeln und Grenzen setzen. Daher braucht es nun einen Mix aus kurzfristigen Ergänzungen der aktuellen Maßnahmen, einer koordinierten nationalen und europäischen Krisenpolitik und eines langfristigen Projekts für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa. In diesem Sinne bringen wir die folgenden Ideen und Forderungen als Parlamentarische Linke in die weitere politische Diskussion ein.
I. Was in Deutschland noch zu tun ist: Jetzt und auf lange Sicht
1.
Das Kurzarbeitergeld und der erleichterte Zugang zu Sozialleistungen helfen vielen Menschen durch die Krise. Insbesondere für Beschäftigte im Niedriglohnsektor, die zudem nicht von aufstockenden Tarifverträgen profitieren, reicht ein Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 bzw. 67 Prozent aber nicht aus. Wir fordern daher eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes für niedrigere Einkommen auf 80 bzw. 87 Prozent und mehr politischen Druck auf diejenigen Branchen, die bisher keine ergänzenden Tarifverträge zur Aufstockung des Kurzarbeitergeldes abgeschlossen haben. Wo Tarifverträge nicht reichen, müssen wir als Politik die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Wir befreien die Unternehmen von den Sozialabgaben, verpflichten sie aber, die Hälfte der Entlastung an ihre Beschäftigten weiterzugeben.
Die Lage vieler Beschäftigter in der Krise ist aber vor allem deswegen so schwierig, weil ihre Einkommen in Normalzeiten zu gering sind. Niedriglöhne sind nicht krisenfest. Ein Mindestlohn von 12 Euro und allgemeinverbindliche Tarifverträge sind ein erster Schritt, diesen Problemen zu begegnen. Dafür erleichtern wir die Allgemeinverbindlicherklärung durch die Abschaffung des Vetorechts der Arbeitgeber und schaffen zudem Anreize für die Mitgliedschaft in Gewerkschaften durch eine stärkere steuerrechtliche Privilegierung der Gewerkschaftsbeiträge.
2.
In der Krise zeigt sich, dass vor allem diejenigen unsere Gesellschaft am Laufen halten, die bislang mit niedrigen Löhnen und wenig Anerkennung zu kämpfen hatten. Die Beschäftigten in der Pflege und dem Gesundheitssektor, im Einzelhandel und in der Logistik, die Rettungskräfte und viele mehr gehen derzeit an ihre individuellen Grenzen, um uns auch in diesen Zeiten bestmöglich zu versorgen. Ihnen gebührt nicht nur unser Dank. Wir unterstützen nachdrücklich die Initiative von Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Bonuszahlungen an die Beschäftigten steuer- und abgabenfrei zu stellen. Darüber hinaus braucht es jetzt zusätzlich zu steuerlichen Vergünstigungen und tariflichen Zusatzvereinbarungen bundesweit einheitliche Bonuszahlungen für diese Beschäftigten. Klar ist: Die Bonuszahlungen dürfen dringend gebotene tarifliche Zusatzvereinbarungen nicht ersetzen und müssen steuerfinanziert sein.
Wir belassen es aber nicht bei Zuschlägen in der Krise, wir werden sie auch anschließend nicht vergessen. Sie verdienen, wie alle anderen auch, gute Arbeitsbedingungen und gute Tariflöhne. Und wir fordern einen breiten Tarif „Soziale Arbeit/Dienste“ und eine bessere Unterstützung von gemeinnützigen Sozialverbänden wie Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und andere.
3.
Menschen in der Grundsicherung, mit geringen Einkommen und kleiner Rente sind von der Corona-Krise ganz besonders betroffen. Preissteigerungen, Hamsterkäufe und andere Folgen setzen ihnen stark zu. Die von Hubertus Heil und Franziska Giffey schnell umgesetzte Anpassung der Grundsicherung und des Kinderzuschlags an die Erfordernisse der Krise helfen vielen Menschen. Ergänzend fordern wir mindestens für die Dauer der Krise eine Anhebung der Grundsicherungsleistungen in Form einer Pauschale von 100 Euro. Besonders Hilfsbedürftige sind Kinder in der Grundsicherung, stehen doch z.B. kostenfreies Mittagessen für Kinder in Kita und Schule oder Tafeln oftmals nicht mehr zur Verfügung. Familien mit Kindern sollte durch eine Erhöhung des Bildungs- und Teilhabepakets oder eine Erhöhung des Kindergeldes, das nicht auf die ALGII oder Grundsicherung angerechnet wird, unbürokratisch geholfen werden. Mit der bereits beschlossenen Grundrente hat die SPD gegenüber dem Koalitionspartner ein gutes Instrument für hilfebedürftige Rentnerinnen und Rentner durchgesetzt, das jetzt auch zwingend zum 1. Januar 2021 wirksam werden muss. Versuche aus der Fraktion der CDU/CSU, die getroffenen Vereinbarungen zu brechen, sind respektlos gegenüber den Menschen, die auch früher schon den Laden am Laufen gehalten haben. Das werden wir nicht hinnehmen.
4.
Zur Sicherung der sozialen Lage von Auszubildenden und Studierenden in der Corona-Krise benötigen wir weitergehende Maßnahmen. Wer akut in Not gerät, weil die Eltern in Kurzarbeit müssen oder weil der eigene Nebenjob verloren geht, muss schnell und vereinfacht Zugang zum BAföG oder einem Härtefallfonds bekommen. Ein Härtefallfonds kann gerade für internationale Studierende ein hilfreicher Ausweg sein, die sonst durchs Raster fallen würden. Zudem sollte der Finanzierungsnachweis für internationale Studierende vorübergehend ausgesetzt werden. Wenn die Studienhöchstdauer aufgrund der pandemiebedingten Umstände überschritten wird, muss eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbürokratisch möglich sein. Das Sommersemester 2020 darf nicht auf die Förderhöchstdauer im BAföG angerechnet werden. Einkünfte aus systemrelevanten Nebenjobs sollen auch für die studentische Krankenversicherung anrechnungsfrei sein. Sowohl Studierende als auch Auszubildende sollen vereinfachten Zugang zum Wohngeld erhalten, wenn sie kein BAföG bekommen können.
Die Allianz für Aus- und Weiterbildung muss jetzt aktiviert werden, damit zwischen den Sozialpartnern konkrete Antworten für die Organisation der beruflichen Bildung gefunden werden können. Vorrang muss dabei die Sicherstellung des Ausbildungsjahres 2020 und 2021 haben. Ein überbetrieblicher Fonds zur Sicherstellung von Auszubildendenplätzen sollte als eine Möglichkeit mit Augenmaß und Verantwortung beraten werden. Darüber hinaus muss gewährleistet werden, dass Auszubildende ihre Ausbildung in einem machbaren Zeitraum erfolgreich abschließen können.
5.
Wir brauchen sofort einen Rettungsschirm für Kommunen. Durch die massiven Einbrüche bei allen Steuerarten, allen voran der Gewerbesteuer, verschärft sich die finanzielle Lage vieler Kommunen gerade massiv. Gleichzeitig gibt es keine Handlungsspielräume, die Einnahmeverluste öffentlicher Einrichtungen auszugleichen, so dass viele kommunale Unternehmen existentiell bedroht sind und sogar relativ finanzstarke Kommunen in Schwierigkeiten geraten. Die Städte, Gemeinden und Kreise stellen unsere technische, soziale und kulturelle Infrastruktur bereit; sie tragen Kultur-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, sichern den öffentliche Gesundheitsdienst und den öffentlichen Personennahverkehr. Damit all das auch in Zukunft möglich bleibt, ist über den weiterhin notwendigen Altschuldenfonds ein kommunaler Rettungsschirm unverzichtbar, denn die Krise trifft alle Kommunen.
Das Corona-Virus macht vor niemandem halt und dennoch sind die Herausforderungen unterschiedlich. Angefangen von der medizinischen Versorgung der gesamten Bevölkerung über die Herausforderungen in bestimmten Problemlagen wie etwa der Obdachlosigkeit, Gewalt gegen Frauen und familienunterstützenden Hilfen bis zur Schaffung guter Rahmenbedingungen für das Homeschooling, müssen die Kommunen handlungsfähig sein. Programme von Bund und Ländern sind zwingende Voraussetzung, allerdings: Vor Ort weiß man am besten, wo es brennt und wo geholfen werden muss. Um diese Handlungsfreiheit zu schaffen, gehört zu einem Rettungsschirm für Kommunen umgehend auch ein von Bund und Ländern getragener kommunaler Sozialfonds.
Überdies ist es nötig, das öffentliche System der Kommunalfinanzierung zu verbessern. Nicht nur in Krisenzeiten sind die Kommunen mit der Finanzierung vieler notwendiger Sozialaufgaben überfordert, zumal die Länder in vielen Fällen keine kommunale Finanzausstattung gewährleisten, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch die Kommunen (Kommunalisierungsgrad) entspricht. Die Kommunen sind zentral für unser Gemeinweisen. Vor Ort leben und arbeiten wir, gehen einkaufen oder müssen zum Arzt, besuchen die Schule oder freuen uns auf einen Theaterbesuch und den abendlichen Sport in unserem Verein. Unser Ziel ist es, die öffentlichen Angebote vor Ort zu erhalten und perspektivisch auszubauen. Unsere Kommunen sind systemrelevant.
6.
Auch wenn die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gelockert werden, gibt es Menschen mit beispielsweise Vorerkrankungen, die weiterhin unseren besonderen Schutz benötigen. Wir werden diejenigen, die für sich das Risiko als zu hoch einschätzen wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen, bis zum Vorhandensein von Impfstoffen nach Kräften schützen und gegebenenfalls auch finanziell unterstützen. Die Mittel aus dem kommunalen Sozialfonds sollen auch für konkrete Unterstützung, Besuche, soziale und gesundheitliche Betreuung und Versorgung von gefährdeten Menschen zur Verfügung stehen.
7.
Im Vergleich zu anderen Ländern ist das deutsche Gesundheits- und Pflegesystem relativ krisenfest. Doch gerade in der Corona-Krise erleben wir, wie es an seine Grenzen stößt. Eine jahrzehntelange Politik der Durchökonomisierung und Privatisierung hat dazu geführt, dass das Gesundheits- und Pflegesystem unterversorgt ist. Angesichts dessen leisten die Beschäftigten Großartiges. Applaus alleine wird indes nicht reichen, um die strukturellen Probleme zu lösen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden bei den Gesundheitsämtern der Länder und Kommunen massiv an Personal gespart, ein Drittel der Krankenhäuser wurde privatisiert und der Klinikbereich wird in hohem Maße aus Beitragsgeldern z.B. zur Bereitstellung von Intensivbetten unterstützt. Gesundheit darf aber keine Ware sein. Deswegen setzen wir uns auch in Zukunft ein für ein krisenfestes und gemeinwohlorientiertes Gesundheitssystem in öffentlicher Hand, die Ausweitung öffentlicher Beschäftigung im Pflege- und Gesundheitsbereich und die Einführung einer solidarischen Bürgerversicherung statt des bisherigen Zwei-Klassen-Systems in Kranken- und Pflegeversicherung. Außerdem darf es im Pflegebereich, der zu einer lukrativen Investition für Kapitalanleger geworden ist, keine Renditeversprechen geben. Das Personal im Pflegebereich muss endlich als Berufsgruppe eingestuft werden, die in einem systemrelevanten Bereich arbeitet. Diese Berufsgruppen, die nicht nur in der Krise an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gehen, brauchen eine generelle Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.
8.
Die Corona-Krise ist die größte Probe für unser Gemeinwesen seit dem Zweiten Weltkrieg. Es wird große Anstrengungen brauchen, diese Herausforderungen zu stemmen. Für uns gilt: Die Kosten der Krise dürfen nicht auf die große Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit geringen und mittleren Einkommen abgewälzt werden. Wo der Staat die Unternehmen mit staatlichen Hilfen unterstützt, braucht es gedeckelte Vorstandsbezüge und das Verbot von Dividendenausschüttungen. Schließlich stehen in einer sozialen Marktwirtschaft die Vorstände und die Anteilseigner an erster Stelle in der Mitverantwortung für den Erhalt des Unternehmens. Und das schließt die persönliche finanzielle Verantwortung mit ein. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um die Krise ohne eine Verschärfung der sozialen Spaltung zu überstehen und um die Wirtschaft durch große konjunkturpolitische Maßnahmen zu stimulieren. Zur Finanzierung der Krisenfolgen brauchen wir eine finanzielle Beteiligung der stärksten Schultern der Gesellschaft. Daher fordern wir eine Abgabe auf besonders hohe Vermögen von über 10 Millionen Euro, eine Anhebung des Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine weitergehende Reform der Erbschaftssteuer.
9.
Schon jetzt ist absehbar, dass die Krisenauswirkungen über den Sommer hinaus fortbestehen werden. Es wird dauern, bis die Wirtschaft wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird und Instrumente wie das Kurzarbeitergeld aufgehoben werden können. Entsprechende Maßnahmen wie etwa das Kurzarbeitergeld oder die Schutzschirme zwischen VermieterInnen und MieterInnen müssen daher so lange wie nötig verlängert werden.
II. Eine koordinierte und solidarische europäische Krisenpolitik
10.
Ohne eine gemeinsame, solidarische Lösung der Corona-Krise steht die europäische Einigung auf dem Spiel. Die Kluft zwischen Arm und Reich innerhalb der Staaten und die Spaltung zwischen schwächeren und stärkeren Mitgliedsstaaten würden sich ohne eine Koordinierung der nationalen und der europäischen Maßnahmenpakete nur noch verschärfen. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Austeritätspolitik ist keine Lösung und verschärft die Krise nur noch, wie wir am Beispiel des kollabierenden italienischen Gesundheitssystems sehen.
11.
Es braucht jetzt eine unbürokratische und schnelle Lösung, um die besonders von der Krise betroffenen Staaten mit Liquidität zu versorgen. Kurzfristig wird der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) bei der gemeinsamen Kapitalbeschaffung helfen. Mittelfristig fordern wir aber die Einführung von Coronabonds für die Deckung der Folgelasten der Corona-Pandemie in Form eines europäischen Solidarfonds. Aus diesem Solidarfonds können notwendige Konjunkturpakete zur Belebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise finanziert werden.
12.
Diese Maßnahmen müssen an die sozial-ökologische Modernisierung Europas gekoppelt werden. Denn auch wenn angesichts von Corona andere Herausforderungen wie die Klimakrise, die zunehmende internationale Konkurrenz oder die ungleiche Entwicklung in Europa, in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit in den Hintergrund treten, bleiben diese Probleme bestehen. Wir müssen sie deshalb genauso koordiniert angehen. Zur Belebung der Konjunktur nach Corona und angesichts der anderen Herausforderungen braucht es ein makroökonomisches koordiniertes Wachstums- und Innovationsprogramm für Europa. Dieses muss die Förderung von Zukunftsmärkten, von Forschung und technischer Innovation mit dem ökologischen Umbau der Wirtschaft, der Förderung von Beschäftigung und guten Arbeitsbedingungen sowie dem Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge verknüpfen. Damit von den Maßnahmen nicht allein die Unternehmen profitieren, müssen die ArbeitnehmerInnen unter anderem durch mehr Mitbestimmung strukturell gestärkt werden und politische Einflussmöglichkeiten ausgebaut werden. Denkverbote helfen uns nicht. Gerade in für die gesellschaftliche Entwicklung wichtigen Bereichen ist es denkbar, dass die öffentliche Hand im Gegenzug für aktive staatliche Förderung Unternehmensanteile erhält. So können die Umsetzung ökologischer und sozialer Standards in der Wirtschaft demokratisch kontrolliert und angesichts zunehmender globaler Konkurrenz heimische Standorte besser geschützt werden. Wir wollen aus dem Green Deal einen Social Green Deal machen.
13.
Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Es muss endlich zu einem Ende des steuer- und sozialpolitischen Dumpingwettbewerbs in Europa kommen. In einem ersten Schritt braucht es eine Harmonisierung der Steuerpolitik, eine europäisch abgestimmte Tarifpolitik und die Einführung eines europäischen Arbeitslosenrückversicherungssystems. Auch so können Spaltung und Ungleichheit in Europa bekämpft werden und der europäischen Idee neues Leben eingehaucht werden.
14.
Wir wollen, dass es in Europa solidarisch zugeht. Deswegen ist es wichtig, dass sich die kriselnden Mitgliedsstaaten über den ESM mit Liquidität versorgen können – ohne unsinnige Sparvorgaben. Klar ist aber auch: Starke Schultern müssen mehr tragen als schwache, denn es kommt jetzt darauf an, die sozialen Fliehkräfte in Europa einzudämmen. Zur Finanzierung der Coronabonds und der konjunkturpolitischen Maßnahmen fordern wir eine effiziente und nachhaltig wirksame europäische Transaktionssteuer und regen die Erhebung einer Abgabe auf besonders hohe Vermögen in Form eines europäischen Lastenausgleichs an. Außerdem müssen die restriktiven Fiskal- und Fördervorgaben innerhalb der europäischen Vertragswerke reformiert werden. Jedes Land braucht jetzt Spielraum, um in der Krise gegensteuern zu können.
15.
Europa ist nicht nur ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Als Wertegemeinschaft darf es jetzt nicht die Schwächsten der Schwachen vergessen. In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln herrschen schlimmste Bedingungen, ein Ausbruch der Corona-Pandemie könnte gravierende Folgen haben. Im Koalitionsausschuss haben wir als SPD nach äußerst zähen Verhandlungen mit der CDU und CSU durchgesetzt, dass den besonders schutzbedürftigen Geflüchteten auf den griechischen Inseln so schnell und unbürokratisch wie möglich geholfen werden soll. Der deutsche Anteil der 1.600 Kinder, auf deren koordinierte Aufnahme sich eine europäische Koalition der Willigen geeinigt hat, muss schnellstmöglich in einer Koalition der Handelnden nach Deutschland kommen. Die Aufnahme dauert schon viel zu lange. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Gefahr durch die Corona-Pandemie müssen die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln evakuiert und annehmbare Aufnahmezentren auf dem Festland geschaffen werden. Wir stellen aber auch klar: Uns reicht das nicht! Insgesamt fordern wir die Bundesregierung auf, auch die Ratspräsidentschaft zu nutzen, um endlich zu langfristigen Lösungen für eine humane, solidarische und rechtssichere EU-Asylpolitik zu kommen. Es darf nicht sein, dass immer wieder auf Notsituationen reagiert wird. Stattdessen muss das Ziel sein, genau diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Diesen Prozess werden wir aktiv begleiten.
16.
Entwicklungsländer werden von der Ausbreitung des Virus und dessen Auswirkungen besonders hart getroffen, vor allem weil hier in Großstädten und dichtbesiedelten Armenvierteln keine soziale Distanzierung möglich ist und Menschen oft keine Wahl haben nicht arbeiten zu gehen. Dazu kommt eine Bevölkerung, die zwar relativ jung ist, aber aufgrund von Mangelernährung und chronischen Krankheiten körperlich geschwächt ist. Es ist zu befürchten, dass diese Länder, in denen schon heute deutliche schlechtere hygienischen Verhältnisse herrschen und in denen die medizinische Versorgung unzureichend ist, auch beim Zugang zu künftigen Medikamenten und Impfstoffen vergessen werden. Daher müssen wir uns für einen gerechten weltweiten Zugang zu den Medikamenten und Impfstoffen gegen das Covid-19-Virus einsetzen und die ausreichende Produktion entsprechend sicherstellen. Und unsere Solidarität sollte sich indes nicht nur auf die medizinische Versorgung beschränken. Wir müssen auf nationaler und europäischer Ebene dringend erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um die Gesundheitssysteme in den Ländern des globalen Südens zu stärken und die wirtschaftlichen und sozialen Schäden abzumildern. In diesem Sinne unterstützen wir auch Schuldenerlasse und Schuldenerleichterungen für die ärmsten Länder.
17.
Das Corona-Virus ist in Windeseile zu einer weltweiten Herausforderung geworden und hat jeden Winkel dieser Welt erfasst. Kein Staat ist optimal auf dieses Szenario vorbereitet gewesen, umso unverzichtbarer wäre nun eine weltweite Kooperation. Doch stattdessen führt uns diese Krise klar vor Augen, dass die internationalen Institutionen derzeit in keiner guten Verfassung sind. Anstatt weltweit Maßnahmen aufeinander abzustimmen und die Verteilung von benötigten Gütern zu koordinieren, konkurrieren die einzelnen Staaten vielfach miteinander und treiben so beispielsweise die Preise für medizinische Schutzkleidung in die Höhe. Und auch wenn es in der Folge in mancher Hinsicht zu einer Deglobalisierung kommen wird, nicht nur bei der Herstellung von Medizinprodukten, sondern auch mit Blick auf weitverzweigte Liefer- und Fertigungsketten in der Industrie, wird unsere Welt auch in Zukunft eine globalisierte sein. Es wird hoffentlich eine Lehre aus dieser Corona-Krise sein, dass wir demokratische und handlungsfähige internationale Institutionen brauchen, die globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die Spaltung in Arm und Reich, kriegerische Konflikte und eben auch Pandemien bewältigen können. Das ist das soziale und demokratische Angebot in einer sich neu aufstellenden Welt. Wir wollen die deutsche EU-Ratspräsidentschaft dafür nutzen.
Das Papier als pdf-Datei zum Download gibt es hier.
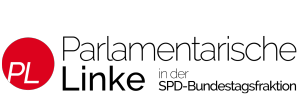
 Foto: Hank Williams, pixabay.com
Foto: Hank Williams, pixabay.com Foto: 272447, pixabay.com
Foto: 272447, pixabay.com


